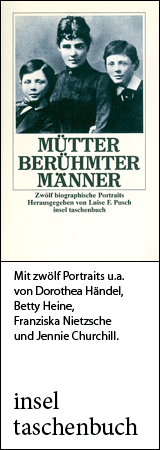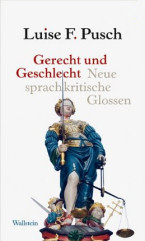Ulrich und Susanne Freund
(Editha Frieda Gisberta von Bonin)
geboren am 14. September 1875 in Elberfeld
gestorben am 3. April 1970 in Rottweil
deutsche Malerin
150. Geburtstag am 14. September 2025
Biografie • Literatur & Quellen
Biografie
Edith von Bonin war die zweitälteste von vier Schwestern. Ihre Eltern waren der Königlich Preußische Kammerherr Dr. jur. Gisbert von Bonin, Rittergutsbesitzer und Verwaltungsjurist, und Maria von Bonin, geb. Freiin von Hurter, verw. van der Heydt. Deren erster Ehemann war nach vier Jahren gestorben; der gemeinsame Sohn Karl von der Heydt wuchs bei den Großeltern auf.
Von den vier Schwestern gingen nur zwei – wie von der Familie erwartet wurde – eine Ehe ein: die älteste Schwester, die Friedrich August Graf Gneisenau heiratete und als Schriftstellerin Maria von Gneisenau bekannt wurde, sowie die zweitjüngste, Olga. Ihre jüngste Schwester Elsa von Bonin hingegen wurde Schriftstellerin und Juristin, Edith von Bonin Malerin.
Ihre frühe Kindheit verbrachte Edith von Bonin noch im Rheinland, bis die Familie nach der Berufung des Vaters ins Berliner Finanzministerium zu Beginn der 1880er Jahre nach Berlin zog.
Im Alter von 25 Jahren begann Edith von Bonin ihre Ausbildung als Malerin. Im Dezember 1900 schrieb sie sich in München an der Damen-Akademie des Künstlerinnen-Vereins ein. Eine Ausbildung an den staatlichen Kunstakademien war Frauen zu dieser Zeit noch verwehrt. Aber schon früh fühlte sie sich zur Malerin berufen, auch wenn sie dabei zumindest nicht auf Zustimmung ihrer Mutter stieß, wie sich ihre Schwester Elsa 1961 in einem Brief an Edith erinnerte:
„Weisst Du, es war zu unserer Zeit garnicht (noch nicht) üblich, dass Töchter taten, was sie wollten. Eltern nahmen das eben schwer übel. Deshalb hatte Mama (…) für mich nicht das allergeringste Verständnis, für Dich auch kaum, sobald es sich zeigte, dass Du Malerin werden wolltest, anstatt weitere Generationen hervorzuzaubern. Wir können ihnen (den Eltern) das nicht übel nehmen. Sie konnten nicht anders.“ (zitiert nach Freund 2021)
Die Verbundenheit mit ihrer Familie macht sich aber in einer ihrer frühesten erhaltenen künstlerischen Arbeiten deutlich: Sie entwarf 1901 die Medaille zum 600-jährigen Bestehen der Familie von Bonin.
Zu ihren Mitstudentinnen in München gehörten u. a. Maria Langer-Schöller, Gertraud Rostosky, Käte Schaller-Härlin und Paula Wimmer.
Auch nach ihrem Studium blieb Edith von Bonin ihrer Ausbildungsstätte weiterhin verbunden. Zwar wurde die Damen-Akademie 1920 aufgelöst, da Frauen nun endlich zum Studium an staatlichen Akademien zugelassen wurden, aber der Künstlerinnen-Verein München e. V. und der ihm angeschlossene Künstlerinnenhilfs-Verein führten ihre Arbeit bis 1967 bzw. 1972 weiter. Edith von Bonin blieb bis zu ihrem Lebensende Mitglied im Künstlerinnenhilfs-Verein, der sie 1960 mit dem Vereins-Ehrenzeichen auszeichnete.
Paris
Im September 1907 zog Edith von Bonin von München nach Paris, um dort „viel zu lernen“. Geplant war ein Aufenthalt von einem Jahr, aber sie blieb bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Eine wichtige Bekanntschaft dort war der Dichter Rainer Maria Rilke, der zu dieser Zeit in Paris lebte und dem ihr Kommen durch ihren Halbbruder brieflich angekündigt worden war. Auch nach ihrer Pariser Zeit setzte sich die Freundschaft in Korrespondenzen und Begegnungen bis 1919 weiter fort.
Konkrete Belege darüber, ob Edith von Bonin in Paris Unterricht an einer Akademie nahm, fehlen. Jedoch beteiligte sie sich bereits im Frühjahr 1908 mit drei Werken an der Jahresausstellung der Société des Artistes Indépendants, einer Ausstellung, die nur durch das Publikum bewertet wurde, also nicht von einer Jury, was zu einer großen Bandbreite an unbekannten bis namhaften Künstlern und Künstlerinnen führte. Sie fand diese Ausstellung allerdings „einfach nicht zum Aushalten“. Dennoch nahm sie ein Jahr später wiederum teil, diesmal mit zwei Zeichnungen. Weitere Beteiligungen an Ausstellungen in Paris sind nicht bekannt.
 Ab Mai 1908 hatte Edith von Bonin nach mehreren Umzügen sowohl ihren Wohnsitz als auch ihr Atelier im Hôtel Biron (dem heutigen Musée Rodin). Da das Gebäude renovierungsbedürftig war, waren kurzzeitige Vermietungen möglich, von denen vor allem Künstler und Künstlerinnen Gebrauch machten. So lebten auch Rodin, Rilke, seine Ehefrau, die Malerin und Bildhauerin Clara Westhoff-Rilke und Käte Schaller-Härlin, Bonins Studienkollegin aus Münchener Zeiten, zeitweilig dort. Kontakt hatte Edith von Bonin auch mit dem KünstlerInnenehepaar Robert Delaunay und Sonia Delaunay-Terk, auch wenn die beiden künstlerisch andere Wege gingen.
Ab Mai 1908 hatte Edith von Bonin nach mehreren Umzügen sowohl ihren Wohnsitz als auch ihr Atelier im Hôtel Biron (dem heutigen Musée Rodin). Da das Gebäude renovierungsbedürftig war, waren kurzzeitige Vermietungen möglich, von denen vor allem Künstler und Künstlerinnen Gebrauch machten. So lebten auch Rodin, Rilke, seine Ehefrau, die Malerin und Bildhauerin Clara Westhoff-Rilke und Käte Schaller-Härlin, Bonins Studienkollegin aus Münchener Zeiten, zeitweilig dort. Kontakt hatte Edith von Bonin auch mit dem KünstlerInnenehepaar Robert Delaunay und Sonia Delaunay-Terk, auch wenn die beiden künstlerisch andere Wege gingen.
Unterbrochen wurde ihre Zeit in Paris durch verschiedene Arbeits- und Studienreisen nach Italien und innerhalb Frankreichs sowie Besuche in Deutschland bei ihrer Familie.
Während dieser Zeit begann Edith von Bonin, ihre Kunstsammlung aufzubauen, finanziert von den Studiengebühren, die sie von ihren Eltern erhielt. Es waren meist Werke aus der Gruppe der – ehemaligen – Fauvisten aus ihrem Umfeld, Othon Friesz, mit dem sie eine enge Freundschaft verband, Raoul Dufy und Henri Matisse, aber es zählten auch Werke von Aristide Maillol und Paul Signac dazu. Etliche Bilder ihrer Sammlung gingen durch Zerstörung und ungeklärtes Verschwinden während des Zweiten Weltkriegs verloren. Ebenso wie die meisten ihrer eigenen in Paris entstandenen Werke bis auf wenige Ausnahmen verloren gingen.
An den von ihr erhaltenen Werken ist deutlich, „dass Paul Cézanne zu einem ihrer prägenden und nachhaltigen Vorbilder wurde“. (Freund 2021) Prägend waren für sie auch die Werke von Othon Friesz. Aber „Edith von Bonin hat die in Paris empfangenen Anregungen nicht einfach kopiert, sondern mit den bereits an der Münchener Damen-Akademie erworbenen Fertigkeiten zu einer persönlichen Malweise amalgamiert.“ (Freund 2021)
Zurück in Deutschland
Als Edith von Bonin im Juli 1914 zu einer Reise nach Deutschland aufbrach, nahm sie die 15 Jahre jüngere Anny Wasner mit, die sie zwei Jahre vorher bei den Delaunays kennengelernt hatte, und die für den Rest ihres Lebens ihre Haushälterin und Vertraute bleiben sollte.
Was sie bei ihrer Abreise nicht ahnte war, dass während ihrer Abwesenheit der Erste Weltkrieg ausbrechen würde und sie somit nicht zurück nach Paris konnte. Dort wurde – wie bei „feindlichen AusländerInnen“ üblich – ihr Besitz in ihrem Atelier und ihrer Wohnung beschlagnahmt.
Nach dem Krieg nahm sie wieder Kontakt mit ihren Bekannten und FreundInnen in Paris auf. Erst 1920 kam sie noch einmal nach Paris zurück. Diesmal jedoch nicht als Malerin, sondern als Übersetzerin für eine Delegation der Freien Stadt Danzig. Sie hatte nicht geplant, ihre alten FreundInnen zu treffen, aber es kam zu Zufallsbegegnungen und sie waren „reizend nett“ zu ihr.
Durch den Verkauf des Berliner Hauses nach dem Tod der Eltern 1912 und 1913 waren die vier Schwestern finanziell abgesichert. So konnte es sich Edith von Bonin leisten, nur für sich zu malen und nur selten eines ihrer Werke zu verkaufen.
Das elterliche Rittergut Brettin im Bezirk Brandenburg erbte ihre Schwester Elsa, d. h. diese erwarb es aus der Erbmasse von ihren Schwestern, da sie ganz besonders an dem Gut hing.
Auch wenn Edith von Bonin Brettin als ihre Heimat ansah und dort immer wieder zu Besuch war, hielt sie sich nach dem Krieg u. a. in München, Berlin, Potsdam, Zoppot (heute Sopot in Polen) und Dachau auf. Reisen führten sie aber auch beispielsweise nach Italien, Österreich und die Schweiz. In Dornburg besuchte sie die Schriftstellerin und Malerin Sophie Hoechstetter, die sie über ihre Schwestern Maria und Olga kannte. Dass sie in dieser Zeit künstlerisch aktiv war, bezeugen zahlreiche Werke, die erhalten geblieben sind.
Auch wenn ihr französisch geprägtes Kunstverständnis dem nationalsozialistischen entgegenstand, wurde Edith von Bonin Anfang 1934 Mitglied der Reichskulturkammer der bildenden Künste, Fachverband: Bund Deutscher Maler und Graphiker e. V. Offene Opposition übte sie nicht aus, sie passte sich den Zeitumständen an, ohne sich den Nationalsozialisten anzuschließen.
Mit ihrer Studienfreundin Gertraud Rostosky blieb sie in regelmäßigem Kontakt. So feierten sie beispielsweise gemeinsam 1938 ein „Malerinnen-Weihnachten“ in der Villa der Malerin Martha Baronin von Khaynach in Bad Tölz. Eine angedachte Wohngemeinschaft der beiden Frauen kam aufgrund fehlenden Wohnraums nicht zustande.
Ab den 1930er Jahren intensivierte sich ihr Kontakt nach Dachau, wo ihre beiden Mitstudentinnen aus ihrer Münchener Zeit Maria Langer-Schöller und Paula Wimmer lebten, und zur dortigen Künstlervereinigung. An derer jährlicher Ausstellung Dachauer Land und Leute im Schloss beteiligte sich Edith von Bonin in den Jahren 1938 und 1939. Persönliche Kontakte zur Vereinigung behielt sie für den Rest ihres Lebens. So waren auch in den Jahren 1960 bis 1965 und 1969 wiederum einige ihrer Werke in den jährlichen Ausstellungen im Schloss vertreten. Es handelte sich dabei um Aquarelle mit Stillleben und Motiven ihrer oberitalienischen Wahlheimat.
Italien
Ab Beginn der 1930er Jahre verbrachte Edith von Bonin aufgrund ihrer „Sehnsucht nach Sonne und Farben“ einen Großteil des Jahres am Gardasee. Aus dieser Zeit sind zahlreiche Pastelle erhalten sowie einige Aquarelle, außerdem mehr als 50 Skizzenhefte.
Spätestens ab 1940 hatte sie dort auch ihren Hauptwohnsitz, erst in Malcesine, wo sie die Jahre des Zweiten Weltkriegs verbrachte, und von 1954 bis 1969 in Torbole del Garda.
Nach dem Krieg blieb sie weiterhin in Italien, nahm aber wieder Kontakt mit ihrer Familie in Deutschland auf. Sie fertigte einige Portraits als Auftragsarbeiten an, auch wenn sie ansonsten „nur für sich“ malte, und gab Sprachunterricht, um ihren Lebensunterhalt zu sichern: „Ich gebe hier Sprachstunden, meist an hoch begabte Kinder – in englisch und deutsch, was ihnen gleichermassen schwer fällt.“ Auch an einer Ausstellung „im Scaligeri-Bau“ nahm sie teil.
Erst Anfang der 1950 war es Edith von Bonin möglich, wieder nach Deutschland und in andere Länder zu reisen, da sie vorher keinen Reisepass hatte. Besuche führten sie in die Schweiz, häufig aber auch nach Rottweil zur Familie von Anny Wasner. Außerdem hielt sie sich mehrfach im Erholungsheim des Münchener Künstlerinnen-Hilfsvereins e. V. in Baierbrunn bei München auf, wo sie auch an den dortigen Ausstellungen teilnahm. Auch besuchte sie weiterhin Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz.
Im August 1969 zog sie nach Rottweil zur Familie Anny Wasners, wo sie im April 1970 starb.
Ihren gesamten künstlerischen Nachlass schenkte sie vor ihrem Tod Anny Wasner, die ihr versprochen hatte, „die Bilder gut zu betreuen“. (Freund 2021) Seit 2019 befindet er sich im Zweckverband Dachauer Galerien und Museen in Dachau und umfasst 37 Ölgemälde auf Leinwand, Malpappe oder Papier, 327 Aquarelle, 659 Pastelle, Kohlezeichnungen und Bleistiftskizzen, 69 Skizzenhefte, rund 300 lose Skizzen und Vorentwürfe.
Die vier Schwestern sowie Erna Schill-Krämer, die Partnerin von Elsa von Bonin, sind in einer gemeinsamen Urnengrabstätte auf dem alten Brettiner Friedhof in der Bonin`schen Familiengrabstätte beigesetzt.
Verfasserin: Doris Hermanns
Literatur & Quellen
Freund, Ulrich und Susanne Freund: Edith von Bonin. Ergebnisse einer Spurensuche. Köln, Wienand, 2021
Freund, Ulrich und Susanne Freund (Hg. und erläutert von): Rainer Maria Rilke – Edith von Bonin. Briefwechsel 1907-1919. Göttingen, Wallstein, 2023
Pötschke, Simone: Erinnerung an Malerin Edith von Bonin. In: Volksstimme vom 23.3.2023
Pötschke, Simone: Malerin Edith von Bonin hat ihre Wurzeln in Brettin bei Genthin. In: Volksstimme vom 21.9.2023
Sollten Sie RechteinhaberIn eines Bildes und mit der Verwendung auf dieser Seite nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit Fembio in Verbindung.