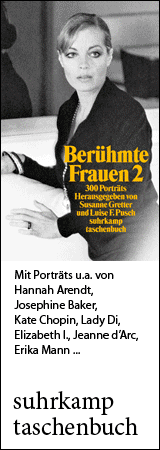(June Millicent Jordan)
geboren am 9. Juli 1936 in Harlem, New York City
gestorben am 14. Juni 2002 in Berkeley, California
US-amerikanische Dichterin, Essayistin, Professorin, Aktivistin
90. Geburtstag am 9. Juli 2026
Biografie • Literatur & Quellen
Biografie
„Als schwarze Frau, als schwarze Feministin, existiere ich gleichzeitig als Teil der Machtlosen und als Teil der Mehrheitsvölker der Welt“.
Es scheint besonders wichtig, die schwarze US-amerikanische Dichterin und Aktivistin June Jordan zu ehren, wegen ihrer tiefen Verbundenheit mit dem palästinensischen Volk. Jordan sah das Schicksal der Schwarzen auf ewig mit dem Schicksal der Palästinenser verknüpft: „zwei Völker, die demselben Imperium gegenüberstehen“. Sie bezeichnete den Kampf der Palästinenser als den „moralischen Lackmustest“ ihres Lebens: „Ich bin als Schwarze Frau geboren, und jetzt / bin ich eine Palästinenserin geworden.“
Ihre Mitaktivistin Angela Davis schrieb:
Als sie sich vor langer Zeit für die Palästinenser einsetzte, wurde June aus vielen Kreisen verbannt. Aber sie machte weiter mit ihrem bemerkenswerten Mut und ihrer Fähigkeit, die Worte zu wählen, die die Menschen zu tiefgreifenden Einsichten bringen - über ihre eigene Verantwortung für eine bessere Welt.
Eine andere Freundin, Alice Walker, die Autorin von The Color Purple, die sich 2011 mutig der Freedom Flotilla nach Gaza anschloss, beschrieb Jordan als „mutig, rebellisch und mitfühlend ... eine Bewohnerin des gesamten Universums. Sie lässt uns an Achmatowa und Neruda denken. Sie ist die Mutigste von uns, die Empörteste. Sie fühlt für alle. Sie ist die universelle Dichterin.“ Und für die Schriftstellerin Toni Morrison war June Jordans Karriere: „Vierzig Jahre unermüdlicher Aktivismus, gepaart mit und angetrieben von makelloser Kunst ... Abgesehen davon war es eine Freude, sie zu kennen.“
Die DichterInnen des Widerstands auf der ganzen Welt haben sich stark mit Palästina verbunden gefühlt. Der südafrikanische Dichter Breyten Breytenbach forderte, dass sich alle Dichter zu „Palästinensern ehrenhalber“ erklären sollten, und Seamus Heaney verband Irland und Palästina in seiner Nobelpreisvorlesung. June Jordan besuchte den Libanon und Palästina und sprach über die Massaker in Sabra und Schatila 1982 während der israelischen Invasion im Libanon. Schon damals konnte sie ihre eigene Mitschuld als US-Steuerzahlerin eingestehen, und in einem Bericht über ihren Besuch sagte sie „Ja, ich wusste, dass mit dem Geld, das ich als Dichterin verdiente, die Bomben und Flugzeuge und Panzer bezahlt wurden, mit denen sie deine Familie massakrierten. . . Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.“ (1985, 106).
Sie starb 2002 im Alter von 65 Jahren an Krebs und erlebte den Völkermord nicht mehr, aber ihr Gedicht „Moving Towards Home“ aus dem Jahr 2005 könnte von heute sein sein:
...weil ich nicht über die unaussprechlichen Ereignisse sprechen möchte
die denjenigen folgen müssen, die es wagen
ein Volk zu „läutern “
denjenigen, die es wagen
ein Volk „auszurotten“
denjenigen, die es wagen
die es wagen, den Menschen als „zweibeiniges Tier“ zu bezeichnen
Denjenigen, die es wagen
„aufzuwischen“
„die Schlinge enger zu ziehen“
„den militärischen Druck zu verstärken“
zivile Straßen mit Panzern zu „umzingeln“
Denjenigen, die es wagen
die Universitäten zu schließen
die Presse abzuschaffen
die gewählten Vertreter zu töten
der Menschen, die sich weigern, geläutert zu werden
das sind die, von denen wir
die Worte unseres Anfangs zurückerlangen müssen ...
Die Herausgeber des 2021 erschienenen Essential June Jordan waren erstaunt, wie oft sie sagten: „Das könnte jetzt geschrieben worden sein! Das ist die Kunst und die Dringlichkeit dieser außergewöhnlichen Dichterin, Aktivistin, Denkerin, Liebhaberin, Kämpferin und Lehrerin, die die gewaltige Aufgabe auf sich genommen hat, uns zu sagen, wer sie war und, was noch wichtiger ist, wer wir sind.“
June Jordan wurde am 9. Juli 1936 in Harlem, New York, als Tochter der jamaikanischen EinwanderInnen Granville und Mildred Jordan geboren. Im Alter von sieben Jahren schrieb sie ihre ersten Gedichte, viele davon über eine schwierige Kindheit mit einem gewalttätigen Vater, der sie schlug, weil sie nicht der Junge war, den er wollte. Sie besuchte eine rein weiße weiterführende Schule in Massachusetts und anschließend das Barnard College. 1955 heiratete sie den weißen Michael Meyer, mit dem sie einen Sohn, Christopher, bekam. Kurz nach ihrer Scheidung im Jahr 1965 beging ihre Mutter Selbstmord. Zu diesem Zeitpunkt begann sie ihre lange Lehrtätigkeit.
Sie unterrichtete in Yale und Wisconsin, an der SUNY (State University of New York) und der CUNY (City University of New York) und schließlich im Fachbereich für afroamerikanische Studien an der UC (University of California in) Berkeley, wo sie von 1989 bis 2002 eine ordentliche Professur für Englisch, Frauenstudien und afroamerikanische Studien innehatte. Sie gründete ihr Programm „Poetry for the People“, das Studenten dazu inspirieren und befähigen sollte, Poesie als künstlerisches Ausdrucksmittel zu nutzen. Sie setzte sich auch für die Verwendung des Schwarzen Englisch im Bildungssystem ein und arbeitete mit ihren Studenten daran, die Struktur des Schwarzen Englisch zu erkennen und es als eine eigene Sprache zu respektieren, anstatt es als gebrochene Version einer anderen Sprache zu betrachten. In Berkeley gibt es ein Wandgemälde zu ihrem Andenken:
Auf dem Gemälde blickt sie nach rechts - in die Zukunft - und fixiert ihren Blick auf die palästinensische Flagge. Der Maler des Wandgemäldes hat eine Black-Power-Faust links von Jordan platziert, die eine Keffiyeh um ihre Schultern trägt. Die Schlusserklärung ihres Gedichts „Moving Towards Home“: „und jetzt bin ich Palästinenserin geworden“, ist an den Rändern des Schals aufgedruckt.
Ihr erstes Buch, Who Look at Me, war ein Kinderbuch und wurde 1969 veröffentlicht. Sie erhielt einen Rom-Preis und 1970 ein Rockefeller-Stipendium. Ihr erster Gedichtband wurde 1977 von Toni Morrison herausgegeben, und im selben Jahr vertonte Leonard Bernstein ihre Texte. Als bisexuelle Frau war sie die erste Afroamerikanerin, die ein Buch mit Liebesgedichten veröffentlichte, Haruko/Love Poems (1994). Sie war produktiv und vielseitig, denn für sie bedeutete Freiheit auch die Freiheit, unberechenbar zu sein, sei es in Bezug auf ihre eigene Sexualität oder auf die Anliegen, für die sie sich einsetzte. Sie konnte ebenso gut eine regelmäßige Kolumne für die Zeitschrift Progressive schreiben wie mit John Adams und Peter Sellars an der Oper I Was Looking at the Ceiling And Then I Saw The Sky (1995) zusammenarbeiten. Sie sagte:
Der Komponist, John [Adams], sagte, er bräuchte das gesamte Libretto, bevor er anfangen könne, also habe ich mich einfach hingesetzt…. und es in sechs Wochen geschrieben, ich meine, das ist alles, was ich getan habe. Ich habe keine Wäsche gewaschen, nichts. Ich habe mich zu 100 Prozent darauf eingelassen.
Nach den Harlem Riots von 1964 war Jordan „von Hass auf alles Weiße und alle Weißen erfüllt“. Gemeinsam mit dem Architekten R. Buckminster Fuller arbeitete sie an einer Neugestaltung von Harlem, um den BewohnerInnen ein besseres Umfeld zu bieten, doch ihr Vorschlag wurde nicht umgesetzt. In ihrem Gedicht über Polizeigewalt von 1974 fragt sie: „Was glaubst du, was passieren würde, wenn wir jedes Mal, wenn sie einen schwarzen Jungen töten, einen Polizisten töten würden?” Eine brennende Frage, die den Rassismus, die Macht und die staatliche Gewalt auf den Punkt bringt.
Jordan brillierte auch als politische Essayistin. Ihre Sammlung Civil Wars (1981) war das erste Werk dieser Art, das von einer schwarzen Frau veröffentlicht wurde. In weiteren Bänden, darunter On Call (1985) und Technical Difficulties (1992), schrieb sie über Südafrika, Nicaragua und den Libanon sowie über Aspekte von Rasse und Klasse in den USA.
Jordans 1971 erschienener Roman His Own Where und ihre 2000 veröffentlichten Memoiren Soldier: A Poet's Childhood, schildern ihre familiäre Situation. Die Beziehung zu ihrem Vater, einem Postbeamten, war turbulent, aber er vermittelte ihr die Liebe zur Literatur, von der Bibel bis zu Shakespeare, Edgar Allan Poe und Paul Laurence Dunbar. Er ermutigte sie, Passagen klassischer Texte auswendig zu lernen, schlug sie aber auch für den kleinsten Fehltritt und nannte sie „verdammtes schwarzes Teufelskind“. Ihre aufopferungsvolle Mutter beging tragischerweise Selbstmord. In einem bewegenden Essay mit dem Titel „Many Rivers To Cross“ schrieb Jordan: „Ich habe über die Vorstellung von meiner Mutter als guter Frau nachgedacht und sie abgelehnt, weil ich nicht verstehe, warum es etwas Gutes sein soll, wenn man aufgibt oder wenn man mit denen zusammenarbeitet, die einen hassen, oder wenn man poliert und bügelt und flickt und sich endlos zurücknimmt für die Menschen, die es lieben, wie man sich tagtäglich still und leise umbringt… Ich arbeite für den Mut, die Wahrheit zuzugeben, die Bertolt Brecht geschrieben hat; er sagt: 'Es braucht Mut zu sagen, dass die Guten nicht besiegt wurden, weil sie gut waren, sondern weil sie schwach waren.'“
Die Jahre, in denen sie als alleinerziehende Mutter zu kämpfen hatte, waren ihre prägenden Jahre als Schriftstellerin. Als bekennende anarchistische Aktivistin war es ihr poetischer Ehrgeiz, eine „Dichterin des schwarzen Volkes“ nach dem Vorbild von Pablo Neruda zu sein. Ihre Gedichte spielen an auf Ereignisse wie die Anhörungen von Clarence Thomas und Anita Hill im Jahr 1991, die Präsidentschaftskampagne von Jesse Jackson im Jahr 1984 und die Polizeiprügel gegen Rodney King im Jahr 1991. Sie schrieb persönliche Gedichte über eine erlittene Vergewaltigung und die Bewältigung einer Krankheit. Darin drückt sie ihre Wut, aber auch ihr Mitgefühl für alle aus, die unter Ungerechtigkeit und Gewalt leiden: Lesben und Schwule, Opfer von Polizeigewalt oder die Menschen in Afrika südlich der Sahara, Nicaragua, Bosnien, Kosovo und Palästina.
Im Juni 2019 wurde Jordan als eine der ersten fünfzig amerikanischen „PionierInnen, WegbereiterInnen und HeldInnen“ in die Nationale LGBTQ-Ehrenmauer im Stonewall National Monument in New York City aufgenommen.
In „A Poem About My Rights“ (Ein Gedicht über meine Rechte), das sie nach der Vergewaltigung schrieb, fordert sie Gewaltopfer auf, der Versuchung zu widerstehen, die Schuld für die Gewalttat zu verinnerlichen. Vielmehr sollen sie die Schuld unmissverständlich den Tätern anlasten. Sie schlägt den Bogen von ihrer persönlichen Tragödie zur Situation von vergewaltigten Menschen überall: „Ich bin die Geschichte der Vergewaltigung / Ich bin die Geschichte der Ablehnung dessen, was ich bin“. Der Unterschied zwischen ihrer Vergewaltigung und der Situation im Südafrika der Apartheid zum Beispiel sei minimal. Ihre Wut über diese Verletzung kommt in den bedrohlichen letzten Zeilen des Gedichts zum Ausdruck: „aber ich kann dir sagen, dass von nun an mein Widerstand / meine einfache und tägliche und nächtliche Selbstbestimmung / dich sehr wohl dein Leben kosten kann.“ Ihre Gedichte sind Liebesgedichte an die Unterdrückten und Ausgegrenzten.
Ihre letzte Sammlung, die sie während ihres Kampfes gegen den Brustkrebs schrieb, ist optimistischer und versöhnlicher, sie ist einer anonymen Geliebten gewidmet und den „Student Poet Revolutionaries“ in ihrem Projekt „Poetry for the People“ in Berkeley. Sie kritisiert Amerikas Bombardierung des Irak, die israelische Zerstörung des Libanon und die Anti-Abtreibungsbewegung, aber die Gedichte sind introspektiv und akzeptierend.
Nach ihrem Tod würdigte Angela Davis June Jordan mit diesen Worten: [Juli 15, 2002]
Niemand, der das Privileg hatte, June Jordan zu kennen - eine Dichterin, die aus ihren Werken vorlas, eine politische Agitatorin, der eine Rede voller Wut hielt, eine Lehrerin, die die Leidenschaft und Bedeutung der Poesie vermittelte, eine Freundin, die über alles Mögliche sprach - konnte sich dem verführerischen, hellen Lachen entziehen, das stets ihre Außerungen akzentuierte. In allem, was June unternahm, war Freude. Manchmal rief ich sie nur deshalb an, um von ihrem ausdauernden Lachen angesteckt zu werden. Ihr lebenslanges Engagement für Gerechtigkeit, Gleichheit und radikale Demokratie schien sich um das Vergnügen zu drehen, das sie empfand, wenn sie einer Welt voller Rassismus, Armut, Homophobie und geistloser Politiker, die entschlossen waren, diesen schrecklichen Zustand aufrechtzuerhalten, schöne Worte entgegenschleuderte. In ihrer Wut lag immer auch Freude. Politik war ihr Leben; kollektiver Schmerz wie auch kollektiver Widerstand waren immer etwas, das sie auf eine zutiefst persönliche Weise empfand. June wird oft als Aktivistin bezeichnet. Viele von denen, die sich an ihrer beharrlichen Verbindung von Poesie und Politik störten, benutzten das Wort „Aktivistin“, um sie zu diskreditieren. Was, so fragten sie, hat die profane Welt der Politik mit Poesie zu tun? Auf der anderen Seite standen die AktivistInnen, die wissen wollten, wie Poesie die Welt verändern kann. June war eine großartige Dichterin und eine mächtige Aktivistin. Mit ihren Worten veränderte sie die Welt der Menschen, und sie schuf dabei Schönheit.
(Text von 2025; ins Deutsche übersetzt von DeepL, korrigiert von Luise F. Pusch)
Verfasserin: Mary Adams
Literatur & Quellen
Jordan, J. (1985). Living Room: New Poems, 1980-1984 (New York: Thunder’s Mouth Press)
Kinloch, V. (2006). June Jordan. Her Life and Letters, Praeger Publishers, Westport, Ct
Levi, J. H, Keller, C. eds. (2021). The Essential June Jordan, Penguin Modern Classics
https://www.junejordan.net/
https://www.enotes.com/topics/june-jordan/critical-essays
Sollten Sie RechteinhaberIn eines Bildes und mit der Verwendung auf dieser Seite nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit Fembio in Verbindung.