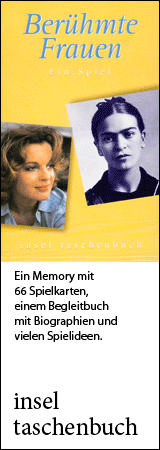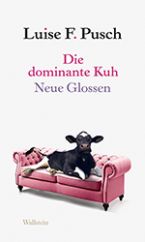Selbstbildnis, um 1850 (wikimedia commons)
geboren am 22. Februar 1821 in Hamburg
gestorben am 25. März 1880 in Florenz
deutsche Schriftstellerin, politische Publizistin, Porträtmalerin und Republikanerin
Biografie • Literatur & Quellen
Biografie
Vorbemerkung der Redaktion: Bis wir mit einer “richtigen” Biografie zu Ludmilla Assing aufwarten können, ist uns diese Buchbesprechung von Hazel Rosenstrauch als vorläufiger Ersatz sehr willkommen.
Viele Frauen sind schon entdeckt, aus der Versenkung und aus dem Schatten von Ehemännern, Onkeln oder Bischöfen geholt worden. Wer aber kennt Ludmilla Assing? Sie war die Nichte Karl August Varnhagens, der seinerseits lange im Schatten seiner berühmten Frau Rahel stand. Vermutlich ist auch der 2022 gegründete Parrhesia-Verlag nur wenigen bekannt, aber im Abseits geschehen bekanntlich oft spannende Dinge.
Ludmilla Assing wurde wegen der Herausgabe der Tagebücher ihres Onkels angeklagt, „wegen Verletzung der Ehrfurcht gegen Se. Majestät den König von Preußen ... Verhöhnungen von Einrichtungen und Anordnungen der Obrigkeit, ... Anreizung zum Ungehorsam gegen die Gesetze, Verordnungen und Anordnungen der Obrigkeit“ etc. zu zwei Jahren Gefängnis und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Sie floh nach Italien und wurde eine Art „Nachrichtenhändlerin“ für deutsche Zeitungen, hat auch schon zuvor Biographien, Essays, Literaturkritiken und zahlreiche Artikel geschrieben. Anlass für ihre Verurteilung war zwar die Herausgabe der Tagebücher Karl August von Varnhagens, sie hat aber auch Briefe Alexander von Humboldts an ihren Onkel herausgegeben, und der berühmte Weltreisende zeigte sich darin von seiner so gar nicht obrigkeitshörigen Seite.
Nun ist in diesem jungen Verlag ein schlicht aufgemachter, 200 Seiten starker Band mit Aufsätzen erschienen, und der Herausgeber Nikolaus Gatter macht im Vorwort klar, dass diese politische Publizistin im 19. Jahrhundert durchaus eine „europäische Reputation“ hatte. Es war sicher nicht einfach, aus der Fülle überlieferter Dokumente eine repräsentative Auswahl zu treffen. Sie beginnt mit einem Bericht über die Märztage 1848, also diese eine Revolution, lebendig und (volks)nah geschrieben, wie es kaum in deutschen Geschichtsbüchern nachlesbar ist. Sie schreibt über die Stimmung bei Versammlungen in den Zelten, über den Verfassungsentwurf und auch darüber, wie die Bürgerwehr das Volk auseinandergetrieben hat. Der Niederschlag dieser „rauen Stürme, welche den politischen Himmel umdüstern“ auf die Kunst ist eine Auseinandersetzung mit Freiheit, Armut und Stolz versus Frömmelei oder „geleckte Manier“. „Wir haben jetzt nur Talente, keine Künstler.“
Fürst Hermann von Pückler-Muskau war ein Freund; ein Aufsatz handelt von dessen Garten in Branitz, „eine großartige Dichtung mit grünen Lettern in den Sand der Lausitz geschrieben“. Der Band enthält Reflexionen über den deutschen Roman, etliche Berichte über das italienische Leben, u.a. in Form der Besprechung italienischer Literatur. Der Text über die „gesellschaftliche Stellung der Frau“ ist zugleich Beschreibung der „großen Veränderungen“ in einer „schmerzhaften Phase des Übergangs“, in der sich „fast alle heute noch herrschenden Regeln – der Moral, des Rechts, der Ehre“ verändern. Nicht jede wird ihre Position teilen, in der Assing dagegen ist, „dem Manne gleich“ zu werden, ihre Frauen wollen beschützt, gestützt und getragen werden, sich nicht der kaltblütigen Entschlossenheit von Männern angleichen. Vor allem sollen sie sich aus der „aufgezwungenen Existenz in Knechtschaft und Abhängigkeit“ befreien, sich bilden und ihre Interessen erkennen. Emanzipation ist in diesen Texten ein sehr weit gefasster Begriff, der neben der sozialen Frage auch die Veränderung der Sitten, von Schauen und Fühlen einschließt. Hier fällt auch der Begriff einer „Emanzipation des Affekts“, und damit ist sie ihrer (auch unserer) Zeit weit voraus. Auch die „Italienischen Briefe“, die in der deutschen Allgemeinen Zeitung erschienen, enthalten ein Lob für selbstdenkende, speziell für schreibende Frauen. Es sind stets politische Texte, die von den (immer noch weitgehend unbekannten) St. Simonisten, dem Jungen Deutschland oder der päpstlichen Regierung in Rom handeln.
Hübsch und aufschlussreich sind die zeitgenössischen Stimmen aus deutschen Zeitungen, die der Herausgeber an den Schluss des Bands gesetzt hat. Bösartig gegen die „Dreistigkeit einer Emanzipierten“, gegen dämonischen Weibergeist und den verderblichen Einfluss durch den Verkehr mit italienischen Revolutionären gerichtet.
„Frauentheorien sind immer epochenspezifisch“ las ich neulich bei dem klugen Literaturwissenschaftler Peter von Matt. Aus der Perspektive betrachtet erschließt dieser Band nicht nur das 19. Jahrhundert, er wirft auch ein aufklärendes Licht auf Irrungen und Wirrungen unserer Epoche.
Verfasserin: Hazel Rosenstrauch
Literatur & Quellen
Assing, Ludmilla. Die Märztage Berlins. Feuilletons, Aufsätze, Berichte. Mit einem Vorwort von Nikolaus Gatter. Parrhesia, Berlin 2025
Dick, Jutta & Marina Sassenberg. Hg. 1993. Jüdische Frauen im 19. und 20. Jahrhundert: Lexikon zu Leben und Werk. Reinbek bei Hamburg. rororo Handbuch 6344.
Frederiksen, Elke. Hg. 1989. Women Writers of Germany, Austria, and Switzerland. New York; Westport, CN; London. Greenwood.
Wilhelmy-Dollinger, Petra. 2000. Die Berliner Salons. Berlin; New York. de Gruyter.
Sollten Sie RechteinhaberIn eines Bildes und mit der Verwendung auf dieser Seite nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit Fembio in Verbindung.