Empfehlungen Marta Karlweis: Die Insel der Diana. Roman 2025. Rezension von Rolf Löchel
Marta Karlweis: Die Insel der Diana. Roman 2025. Rezension von Rolf Löchel
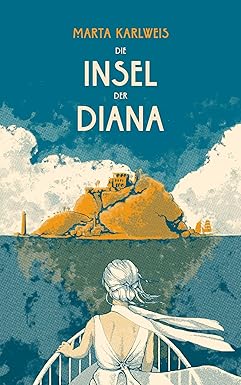 Ebenso wie Else Jerusalem und Maria Lazar zählt Marta Karlweis zu den Autorinnen des frühen 20. Jahrhunderts, um die sich der Verlag das vergessene buch wiederholt verdient gemacht hat, indem er ihre Bücher neu oder gar erstmals aufgelegt hat. Von Karlweis waren dies bislang etwa Das Gastmahl auf Dubrowitza, Ein österreichischer Don Juan und Schwindel. Nun hat der Verlag mit Die Insel der Diana den Erstling der Literatin folgen lassen. Verfasst hat sie ihn von 1916 an, erschienen ist er 1919. Für ein Debüt bietet er nicht nur eine überraschend komplexe und anspielungsreiche Handlung, sondern auch ein erstaunlich großes, ja kaum unüberschaubares Figurenkabinett aller Klassen und Charaktere, in dem sich die Lesenden schon einmal verlaufen können.
Ebenso wie Else Jerusalem und Maria Lazar zählt Marta Karlweis zu den Autorinnen des frühen 20. Jahrhunderts, um die sich der Verlag das vergessene buch wiederholt verdient gemacht hat, indem er ihre Bücher neu oder gar erstmals aufgelegt hat. Von Karlweis waren dies bislang etwa Das Gastmahl auf Dubrowitza, Ein österreichischer Don Juan und Schwindel. Nun hat der Verlag mit Die Insel der Diana den Erstling der Literatin folgen lassen. Verfasst hat sie ihn von 1916 an, erschienen ist er 1919. Für ein Debüt bietet er nicht nur eine überraschend komplexe und anspielungsreiche Handlung, sondern auch ein erstaunlich großes, ja kaum unüberschaubares Figurenkabinett aller Klassen und Charaktere, in dem sich die Lesenden schon einmal verlaufen können.
Anders als ihre göttliche Namensgeberin verteidigt die Titelfigur keineswegs das, was junge, unverheiratete Frauen verheirateten alten Herren zufolge unbedingt bewahren sollen, ihre sogenannte ‚Jungfräulichkeit’ nämlich. Es sei denn sie haben selbst ein Auge auf eine dieser jungen Frauen geworfen. Noch etwas anderes unterscheidet die Protagonistin von ihrer Namenspatronin: Sie pflegt ungleich seltener als Jupiters Tochter auf Pirsch zu gehen. Und wenn sie dies tut, dann natürlich nicht mit Pfeil und Bogen. Hingegen mag sie der mythologischen Figur darin gleichen, dass sie eine besondere „Kühnheit des Profils“ auszeichnet und sie einen „sehnig[en und stark[en]“ (7) Körper ihr Eigen nennen kann. Diese männlich konnotierten Eigenschaften mögen sich darauf zurückführen lassen, dass sie in jungen Jahren „wie ein Knabe [gehalten]“ (11) wurde. So lernte sie nicht nur „Griechisch, Latein und Mathematik“, sondern auch „reiten, fechten, schießen“ und ertüchtigte sich überhaupt durch „jede erdenkliche Leibesübung“ (ebd.).
Gerade einmal achtzehn Jahre alt, lernt sie den wesentlich älteren Stephan kennen und verliebt sich ungeachtet seines mehr als fragwürdigen Charakters in ihn. „Sie bemächtigte sich des Menschen, der ihre Liebe erweckt hatte, gleichviel, wie er war, sie dachte nicht an Eigenschaften. Sie empfand das Einmalige, Endgültige ihres Gefühls“ (42). Wie sich zeigen wird hat sie sich da gründlich getäuscht – oder vielleicht doch nicht? Jedenfalls „begehrt[.]“ auch er „sie zum Weib“. Ihr die Ehe anzutragen „schien ihm die reinste Höhe seines Lebens. Ehe war ein heiliges Wort“. Denn erst einmal verheiratet waren „Ziererei und Weigerung […] ausgeschlossen“ (ebd.). Diese Anspielung auf die sogenannten ehelichen Pflichten lassen Stephans ebenso geilen wie misogynen Blick auf Diana und alle ihre Geschlechtsgenossinnen mehr als nur ahnen.
Beide heiraten und „zuweilen fiel es ihm ein, Rechte geltend zu machen. Sie fügte sich, lächelnd, mit halb zerstreuter Geschmeidigkeit des zärtlichen Körpers“ (126). Ansonsten erzählt er Diana gerne von seinen zahllosen Liebschaften und „rühmt“ die „behende Gefügigkeit“ (53) der anderen Frauen.
Der schon als Knabe eitle Mann, dem die Erzählstimme eine „Findigkeit seines frühverschlagenen Köpfchens“ (19) und einen „frauenhaft flinken Verstand“ (230) zuschreibt, ist nicht nur die zweite Hauptfigur des Romans, sondern steht mit seinen „zahlreichen Liebesabenteuern“ (21) und blühenden Geschäften recht eigentlich im Mittelpunkt der Handlung, in der er sich als ebenso skrupelloser wie erfolgreicher Geschäftsmann erweist, der sich quer durch die Frauenwelt nicht nur Europas schläft und mehr als ‚nur’ eine 17-Jährige auf dem Gewissen hat. Überdies entwickelt Stephan eine homophile Zuneigung zu seinem Halbbruder. Eine Frau, die er „nicht zu erobern“ vermag, „haßt“ er (135f.) In einem solchen Fall kennt er „nur eins: Er mußte sie zwingen“. Überhaupt blickt er auf seine Mitmenschen herab, die er alleine schon dafür verachtet, wenn sie „ihre Meinungen äußerten“, auf die doch „niemand achtete“ (260). Nur er „und einigen Anderen, die die Macht besaßen“ (ebd.) lenkten den Lauf der Dinge. „Oder vielmehr, sie vollzogen sich auch nach seinem und jener wenigen Anderen Gutdünken nur scheinbar, denn sie hatten ihr eigenes Gesetz. Und dieses Gesetz war unabänderlich und böse“ (ebd.). Mit all seinen Eigenschaften, Einstellungen und egozentrischen Handlungen ist er alles andere als ein Sympathieträger, wie die Männer des Romans überhaupt negativer gezeichnet sind als die Frauen. So ist Stephan denn auch keineswegs der einzige, der seine misogyne Sexualität auslebt. Dafür aber sind die weiblichen Figuren nicht selten jünger und naiver als ihre männlichen Konterparts.
Bei der Frau, die Stephan, trotz der Ehe, nicht wirklich zu besitzen vermag, handelt es sich um Diana, die aus dem gemeinsamen Leben mit ihm ausbricht, nachdem er eine Liebesbeziehung mit seiner Stiefschwester eingegangen ist. Diana reicht zwar nicht die Scheidung ein, doch verlässt sie ihn und siedelt auf ihre damals noch ebenso karge wie unwirtliche und nur von einigen ärmlichen Fischerfamilien bewohnte Insel vor der kroatischen Küste über. Sie war ihr durch eine Erbschaft zugefallen. Bald nach ihrer Ankunft auf dem malariaverseuchten Stückchen Erde und den Einheimischen noch fremd leistet Diana einer hochschwangeren Frau bei der Niederkunft Hebammendienste, wobei der „Kampf der Geburt“ (86) ungeschönt und für die Zeit sehr realistisch beschrieben wird. Er setzt damit ein, dass „das Weib mit den Füßen den schmutzigen Sack beiseite [schlug], der ihre Beine bedeckt hatte, und Diana […] zwischen den gekrümmten Schenkeln eine rötlich vorgedrängte Kugel, von Haar bedeckt, den Kopf des Kindes, das geboren wurde [, entdeckte]“ (83). Zwar stirbt das Kind schon bald, doch hat ihre Hilfe Diana das Vertrauen der Fischerfamilien eingebracht. Dies umso mehr, als es ihr gelingt, die Insel von der Malaria zu befreien und urbar zu machen.
Diana fühlt sich auf ihrer vom Meer umgebenen Heimstatt schon bald nicht nur heimisch, sie identifiziert sich geradezu mit ihr. „Das alles habe ich geschaffen. Das alles ist mein Leben, mein ganzes einzigstes, allereinzigstes Leben!“ (329) Doch muss sie zugleich beklagen, dass ihr die Insel nicht mehr gehört. Denn sie musste einen Kredit aufnehmen, um sie nicht nur bewohnbar zu machen, sondern zu einer touristischen Attraktion auszubauen, wodurch sich der Charakter der Insel grundlegend änderte und die dort heimischen Menschen nun ein besseres Leben führen können. Doch hat Diana durch die Kredite ihre Eigentumsrechte an der Insel verloren, die, ohne das sie es ahnt, von Stephan aufgekauft werden.
Im Laufe der Handlung macht die von Beginn an freiheitsliebende, aber vielleicht noch ein wenig naive Protagonistin einen Lern- und Wandlungsprozess durch. Dies geschieht auch mithilfe anderer Frauen, die ihr aus guten Gründen raten: „Vertrauen Sie nicht, vertrauen sie nicht! Frauen werden verwüstet, wenn sie vertrauen“ (327). Zwar scheint Diana gegen Ende des Romans zu resignieren. Sie beginnt zu „glaube[n], das Leben aller Weiber, die sich im Geheimsten nicht bescheiden, ist zweckloses Anrennen gegen Windmühlen“ (404). Doch überwindet sie diese Resignation tatkräftig zuletzt doch. Denn es ist zwar „soviel Böses geschehen, irgendwo muß doch das Gute anfangen“ (430).
Im Laufe der Handlung werde Klassenunterschiede zwar dann und wann angesprochen, aber nicht weiter ins Zentrum gerückt. Mehr als deutlich wird allerdings, dass Geld „die gierigste[.] und atemloseste[.] aller Bestien“ (109) ist. Auch scheint gelegentlich Antisemitismus auf, der womöglich der Autorin selbst anzulasten ist. So ist davon die Rede, dass ein „jüdische[r] Ladendiener[.] […] eine geringe Kundschaft schon bei ihrem Eintritt abtaxiert“ (148), und „bleiche Judenknaben […] frech und vorlaut“ (242) auftreten. Seinen Höhepunkt erreicht der Antisemitismus in der Nebenfigur Jakob Ephraim Hirsch, der Karlweis unter der Hand zur Karikatur gerät, da sie ihm so ziemlich jedes erdenkliche antijüdische Klischee andichtet. So hat „der kleine Jude […] einen huschenden, mißtrauischen, listigen Blick“ (150) und Stephan kann sich „vorstellen, daß er sich heimlich zarte Christenkinder braten läßt“ (142). Wenn Stephan ihm „jüdische List und Altweibereigensinn“ (199) anlastet, geht sein Antisemitismus mit Misogynie einher, was ja bekanntlich tatsächlich nicht selten der Fall ist. Schließlich wird Hirsch durch Stephans finanzpolitische Winkelzüge ruiniert, womit das Klischee vom skrupellosen jüdischen Geschäftemacher in Stephan gerade konterkariert wird.
Auch kennt die Erzählinstanz nicht selten die tiefsten Geheimnisse ihrer Figuren. Zu Beginn werden deren Charaktereigenschaften zwar eher beschrieben als gezeigt, doch ändert sich das erfreulicherweise im weiteren Verlauf.
Gelegentlich greift Karlweis zu Bildern und Metaphern, mit denen sie die Lesenden unmittelbar in die Atmosphäre eines ruhigen Sonnenaufgangs am Ufer versetzt: „Das Meer roch stark und keusch, und die Luft war durchsichtig und still, die Stunde hielt den feuchten Atem an“ (98). Oder sie lässt ihr Lesepublikum gemeinsam mit Diana den Blick über die von ihr so erfolgreich veränderte Insel schweifen: „Unter ihnen schmeichelten sich die Feigengärten und der Wein bis an das Meer. In silbergrauen Trüppchen standen die Oliven beisammen, als flüsterten sie einander Geheimnisse zu“ (342).
Auch scheut die Autorin nicht vor einer scheinbaren Contradictio in Adjecto zurück, wenn sie denn passt, weil durchaus jemand etwas „leise aus[rufen]“ (46) kann. Beim „Platzen der feinen Kalkwand eines Eises“ (282) scheint sich allerdings ein Tippfehler eingeschlichen zu haben.
Herausgeber Johann Sonnleitner hat dem Roman ein Nachwort beigefügt, das wie alle seine Nachworte für im verlag das vergessene buch erschienenen Bücher eine ebenso konzise wie informative Beschreibung des Lebens und des Werkes der jeweiligen Autorin und ihres literarischen Nachlebens sowie einige kluge Anmerkungen zum je vorliegenden Werk bietet. Sein lobender Befund, dass Karlweis’ „komplexer Roman“ von einem „diskret eingesetzte[n], beeindruckende[n] Anspielungs- und hintergründige[n] Bedeutungsreichtum grundiert“ (463) wird, soll hier den Schlusspunkt setzen.
Vorheriger Eintrag: Sabine Haupt, “Bienenkönigin Blaue Kreise” Roman, und (Hg.) “Wege durch finstere Zeiten. Afghanische und Schweizer Texte über Flucht und Asyl” 2025. Sammelrezension von Rolf Löchel

